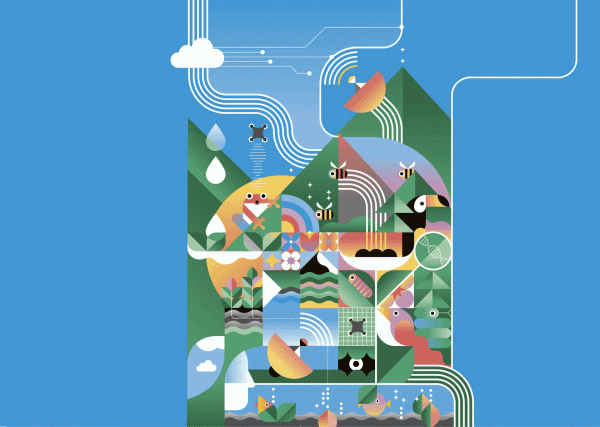Vom Riff ergriffen

Vom Riff ergriffen
Weil die Gesundheit der Ozeane akut gefährdet ist, verliess die Meeresbiologin Ulrike Pfreundt die akademische Laufbahn und gründete ein Unternehmen, das sich dem Bau und der Restaurierung tropischer Korallenriffe verschrieben hat.
Das ETH-Spin-off rrreefs ist ein Unternehmen – inwiefern ist dessen Mission, bis 2034 ein Prozent der küstennahen Riffe zu regenerieren, für Sie eine persönliche Angelegenheit?
ULRIKE PFREUNDT – Ich war schon immer ein Naturmensch. Ursprünglich bin ich mikrobielle Ozeanografin und habe viel in den tropischen Ozeanen geforscht. Je mehr ich über diesen Lebensraum gelernt habe, desto mehr realisierte ich, wie schlecht es ihm geht. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Im Englischen gibt es dafür den Begriff des «environmental grief». Ich habe mich deshalb entschieden, die akademische Laufbahn aufzugeben und im Meeresschutz aktiv zu werden. Gemeinsam mit drei Mitgründerinnen habe ich ganz bewusst den Start-up-Weg gewählt, weil ich die Challenge annehmen wollte, ein regeneratives Businessmodell zu entwickeln.
«Partizipative Prozesse und Co-Design mit lokalen Communities sind entscheidend für unseren Erfolg.»
Wie sieht dieses Modell aus?
Intakte Korallenriffe sind für gesunde Ozeane von immenser Bedeutung: Fast ein Drittel aller bisher bekannten Lebewesen im Ozean sind von Korallenriffen abhängig, weshalb sich ihr Verlust verheerend auf die Stabilität mariner Ökosysteme auswirken könnte. Zudem bieten Riffe Nahrung und Einkommen sowie Schutz vor Küstenerosion für Hunderte Millionen Menschen. Hier setzen wir an, aktuell beispielsweise in der Pujada-Bucht auf den Philippinen: Seit knapp zwei Jahren arbeiten wir an einem Regenerationsprojekt. Dafür bauen wir gerade die erste lokale Anlage für den 3D-Druck unserer Riffmodule. Dies senkt die Produktionskosten unseres Riffsystems signifikant und schafft Wertschöpfung vor Ort. Die Stiftung Fourfold ermöglicht uns, Menschen auszubilden, die in der Pujada-Bucht leben und sehr motiviert sind, etwas für ihr Riff zu tun: Sie lernen zu tauchen, machen sich mit unserem Modulsystem vertraut und bilden sich in wissenschaftlichem Monitoring weiter. So entstehen starke lokale Teams. Partizipative Prozesse und Co-Design sind hierfür entscheidend. Beispielsweise fragen wir die Fischer, wo ein Riffbau am nötigsten wäre, damit die Fische zurückkehren. Sie, die ihre Riffe ja sehr gut kennen, möchten wir auch gern im Monitoring einbinden und ihnen so ein alternatives Einkommen zum Fischfang ermöglichen. Wir beziehen also den ganzen sozioökologischen Zusammenhang mit ein und entwickeln ein Modell, das sich auf vergleichbare Länder übertragen lässt.

© Angela Alegria
Wie will rrreefs Geld verdienen?
Wir verfolgen zwei Geschäftsfelder, mit denen wir seit zwei Jahren Umsatz generieren: Einerseits arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die sich im Rahmen ihrer Corporate Sustainability oder Supply Chain Resilience für die Biodiversität in den Ozeanen engagieren wollen. Hier bieten wir ein Paket aus Umsetzung, Monitoring, Reporting und Storytelling. Andererseits sind wir für den Tourismus und die Hotellerie interessant: Als Resortbesitzer ist ein sterbendes Riff nicht gut fürs Geschäft. Wir bieten Riffreparaturen oder auch ganze Riffe an. Im Tourismusmarkt boomen aktuell sogenannte «regenerative experiences»: Wir entwickeln Programme, die es Hotelgästen ermöglichen, am Riff mitzubauen.
Ihr erstes künstliches Riff haben Sie vor der kolumbianischen Insel San Andrés gebaut – wie geht es ihm nach bald vier Jahren?
Neulich hatten wir zum ersten Mal einen Hai drin, das war fantastisch! Weniger anekdotisch lässt sich sagen, dass sich die Fischvielfalt und die Biomasse etwa auf der Höhe des benachbarten natürlichen Riffs bewegen, was ein gutes Ergebnis ist. Die Korallen wachsen langsamer, als wir gehofft hatten, was vermutlich an gehäuften Hitzeperioden liegt. Auf den Philippinen wachsen sie viel schneller! Toll ist, dass an jedem unserer Riffe jeder Messpunkt eine Zunahme an Jungkorallen zeigt, das heisst, es werden immer mehr!
Was entgegnen Sie auf den Einwand, wir müssten primär den Klimawandel bekämpfen, um das Riffsterben zu stoppen?
Alle Lösungen, auch unsere, werden uns nicht helfen, Korallenriffe in die Zukunft zu retten, wenn wir nicht parallel gegen den Klimawandel arbeiten. Irgendwann stirbt alles, wenn es zu heiss wird. Was wir erreichen können, ist, dass es noch lang genug an verschiedenen Orten der Welt Korallenriffe gibt, damit sie langfristig weiter existieren können. Jetzt brauchen sie Nothilfe, denn den Riffen geht es schlecht.
Wie schaffen Sie es, Ihr Ziel, bis 2034 700 km Riffstruktur zu regenerieren, zu erreichen?
Wir schaffen es, wenn wir die Fläche, die wir regenerieren, jedes Jahr verdreifachen. Das ist ambitioniert, aber nicht unmöglich. Wir werden an sehr vielen Orten gleichzeitig lokale Teams brauchen, die Projekte umsetzen. Parallel dazu erarbeiten wir eine Strategie für industrialisierte Länder, die auf stärker automatisierte Verfahren setzt. Unser Hauptsitz wird in Zürich bleiben. Einerseits sind wir hier in der Nähe unserer Kunden. Andererseits sind wir in der Nähe der Talente, die wir brauchen, namentlich aus der ETH.
Ihr Vorhaben ist eine Herkulesaufgabe – wie bleiben Sie optimistisch?
Wir haben eine wahnsinnig tolle Community, die uns ständig motiviert, und durch das Feiern kleiner Erfolge! Und weil ein Momentum zu spüren ist. Es gibt immer mehr Menschen, die sich um die Ozeane kümmern und an Lösungen arbeiten – wir brauchen sie alle!
Stocker Lab
Seinen Ursprung nahm rrreefs am Institut für Umweltingenieurwissenschaften der ETH Zürich: Von 2016 bis 2020 war Ulrike Pfreundt Postdoctoral Fellow im Team von Professor Roman Stocker. Hier erforschen Biologinnen zusammen mit Physikern, Ingenieurinnen und Mathematikern, wie Mikroben und Kleinstlebewesen die Ökologie der Meere gestalten. Das Stocker Lab wird unter anderem von der Simons Foundation sowie von der Gordon and Betty Moore Foundation gefördert.